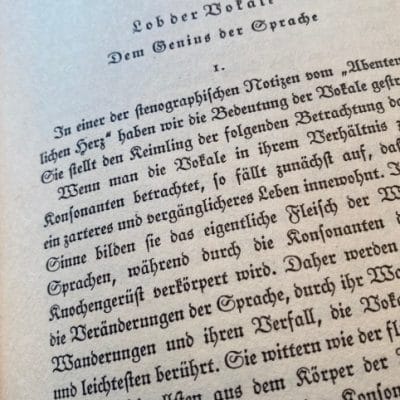Es gibt unzählige Sprachratgeber. Und alle sind sich in einem Punkt einig: Man solle negative Formulierungen möglichst vermeiden und die Dinge positiv ausdrücken. Das Negative schreckt – so die Überzeugung der Autoren – ab und verhindert so, dass der Adressat eines Textes sich mit ihm auseinandersetzt.
Natürlich sind positiv formulierte Botschaften sympathischer, klarer, eindeutiger und in manchen Fällen einer Negativformulierung unbedingt vorzuziehen. Etwa bei einer Liebeserklärung.
Doch in anderen Lebenslagen hat auch die Negativformulierung ihre Daseinsberechtigung. Zum einen gibt es Dinge, die – würde man sie positiv ausdrücken – einen Charakter annehmen, den sie nun einmal nicht haben. Das Böse, positiv formuliert, wäre dann ja plötzlich das Gute. Positive Sprache wäre in diesem Fall eine Lüge. Und wahrscheinlich ist sie genau deshalb auch in der Werbesprache so beliebt.
Negativformulierungen haben aber noch aus einem Grund ein Bleiberecht: Sie erlauben es, Licht und Schatten auszudrücken und zu differenzieren. Von der Sprache zu verlangen, auf Negativformulierungen zu verzichten, käme einer Aufforderungen an den Maler gleich, nur noch helle und freundliche Farbtöne auf seiner Palette zu dulden.