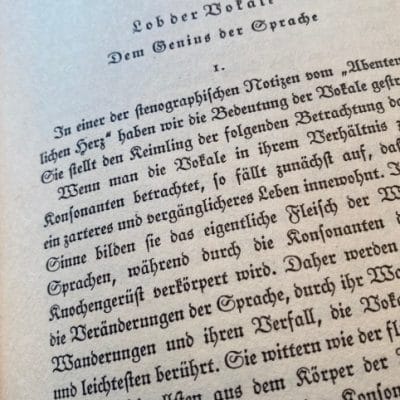Die Sache mit der Fokussierung: Die Leute tun so, als hätten sie statt eines lebendigen Hirns eine Art Kameraobjektiv im Kopf, das sie nur scharf stellen müssten, um ein Problem zu erfassen und zu lösen. Was in diesem Fall tatsächlich stattfindet, ist eine isolierte Problembetrachtung ohne Einbeziehung von Hintergrund und Umfeld.
Legt man mit dem Bogen auf ein Ziel an, nimmt man nicht sofort das Ziel ins Visier – man sondiert die Umgebung: Wo befinde ich mich, woher weht der Wind, gefährde ich jemanden mit meinem Schuss, wie fühle ich selbst mich. Man weitet den Geist und schränkt ihn eben gerade nicht ein. Dann sammle ich mich auf mein Ziel, konzentriere mich: Der Bogen ist gespannt – meine Aufmerksamkeit auch. Ganz ähnlich sollte man auch beim Denken und Sprechen verfahren.
Also sich nicht sofort in das verbeißen, was man für das Problem hält. Sondern möglichst viele Umstände mit einbeziehen – spürend, fühlend, sinnend. Ich nehme alles in mich auf. Ich unterziehe meine Umgebung dabei nicht reflexhaft einer vordergründigen Bewertung, sondern inhaliere sie gleichsam, atme sie ein. Weite statt Enge.
Wenn mein Geist als sprachformende Instanz klar und transparent sein soll wie ein Kristall, folgt daraus dann nicht, dass die Gesetze der Kristallbildung auch für meinen Geist gelten? Die Wirkung in meinem Geist fände dann zuerst auf molekularer Ebene statt, erst dann und nachgeordnet folgt die intellektuelle.